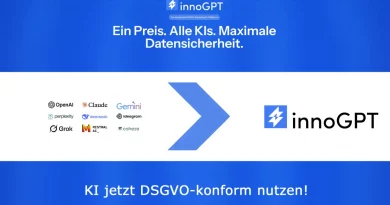KI im Mittelstand – So wird künstliche Intelligenz zum echten Erfolgsfaktor
Autor: Dr. Torben Hügens, Vice President Business Analytics Germany bei der All for One Group SE/dcg
Im Vertrieb werden Standard-Anfragen mittlerweile automatisch beantwortet, im Kundenservice hilft ein Chatbot bei der Bearbeitung häufiger Anliegen – doch Angebote werden weiterhin manuell erstellt. In vielen mittelständischen Unternehmen ist Künstliche Intelligenz inzwischen angekommen, allerdings oft in Form einzelner Insellösungen, die nebeneinander existieren und kaum miteinander verbunden sind. Der operative Alltag zeigt: Das Potenzial ist zweifellos da. Doch statt flächendeckendem Effizienzgewinn herrscht häufig Stückwerk.
Woran liegt das? Wer KI erfolgreich einsetzen möchte, muss mehr tun, als eine neue Software zu implementieren. Es geht darum, die richtigen Voraussetzungen zu schaffen, tragfähige Anwendungsfälle zu identifizieren und die Organisation aktiv einzubeziehen. Erst wenn Technik, Prozesse und Mitarbeitende zusammenwirken, entfaltet KI ihr volles Potenzial im Alltag. Drei Faktoren haben sich in der Praxis dabei als besonders entscheidend erwiesen: eine belastbare Daten- und Systemlandschaft, eine strategisch ausgerichtete Auswahl an Use Cases und ein kultureller Wandel, der Technologie mit Akzeptanz verbindet.

1. Eine verlässliche Datenbasis ist mehr als technischer Unterbau
Die Arbeit mit KI beginnt bei den Daten. Damit Algorithmen Prozesse effizienter gestalten oder Vorhersagen treffen können, benötigen sie Zugriff auf aktuelle, strukturierte und qualitativ hochwertige Informationen. In der Realität sind die Daten in vielen Unternehmen jedoch über verschiedene Systeme verteilt. Produktionskennzahlen liegen auf Maschinenrechnern, Kundeninformationen im CRM, Einkaufsdaten im ERP. Diese Fragmentierung führt dazu, dass KI-Anwendungen entweder auf unvollständigem Input beruhen oder gar nicht erst starten.
Die technische Lösung besteht nicht darin, alle Daten an einem Ort zu speichern, sondern eine Infrastruktur zu schaffen, die verschiedene Quellen miteinander verknüpft. Plattformen wie die SAP Business Data Cloud ermöglichen genau das. Sie nutzen sogenannte semantische Schichten, die es erlauben, Daten in Echtzeit zu analysieren, ohne sie physisch zusammenführen zu müssen. Gleichzeitig bieten sie Funktionen zur Datenqualitätssicherung, Zugriffskontrolle und automatisierten Validierung – wichtige Voraussetzungen, um Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten.
Unternehmen, die frühzeitig in eine moderne Datenarchitektur investieren, schaffen damit die technische Grundlage für KI-Projekte und verbessern auch ihre Entscheidungsfähigkeit im Tagesgeschäft.
2. Klar definierte Use Cases sind der Schlüssel zur Umsetzung
Viele Unternehmen starten mit KI, ohne sich im Vorfeld klarzumachen, welches Problem die Technologie eigentlich lösen und wie KI auf das Unternehmensziel einzahlen soll. Ohne eine klare Strategie, welches konkrete Problem gelöst werden soll und mit welchen technologischen Lösungen, bleibt der Mehrwert oft aus. Das führt dazu, dass Anwendungen zwar technisch funktionieren, aber im Alltag kaum einen Unterschied machen. Statt an vielen Stellen gleichzeitig kleine Projekte zu starten, ist es zielführender, gezielt Prozesse zu identifizieren, die von KI wirklich profitieren.
Geeignete Anwendungsfälle finden sich häufig in Bereichen mit hohem Datenvolumen, wiederkehrenden Aufgaben oder großem Interpretationsspielraum. Dazu gehören zum Beispiel die automatische Analyse von Qualitätsdaten in der Produktion, die intelligente Vorhersage von Wartungsintervallen anhand von Maschinensensorik oder die Verarbeitung unstrukturierter Dokumente im Einkauf oder der Buchhaltung. Gerade SAP-Nutzer können hier schnell starten: In SAP S/4HANA gibt es zahlreiche „Embedded AI“-Funktionen, etwa zur Belegerkennung, Zahlungsprognose oder Bedarfsvorhersage. Diese nutzen vorhandene Transaktionsdaten direkt und lassen sich ohne große Vorlaufzeit produktiv einsetzen. Für Effizienzsteigerung im Alltag eignen sich solche Standardlösungen besonders gut, zur echten Wettbewerbsdifferenzierung braucht es hingegen oft maßgeschneiderte KI-Anwendungen.
Für den Einstieg eignen sich besonders gut Projekte mit überschaubarem Umfang und klar messbarem Nutzen. Wer ein erstes Pilotprojekt erfolgreich umsetzt, etwa durch eine automatisierte Prüfung von Eingangsrechnungen, schafft Vertrauen bei den Mitarbeitenden und sammelt wertvolle Erfahrung für die nächste Ausbaustufe. Erst wenn diese ersten Schritte greifen, lohnt es sich, über komplexere Modelle oder skalierte Plattformlösungen nachzudenken.
3. Veränderung gelingt nur mit Beteiligung
Die Einführung von KI ist nicht nur eine Frage der Technik. Sie verändert Rollen, Prozesse und das Selbstverständnis vieler Mitarbeitenden. Daher ist es wichtig, von Anfang an eine offene, verständliche und transparente Kommunikation zu führen. Mitarbeitende sollten nicht das Gefühl haben, dass ihnen etwas „übergestülpt“ wird oder sie gar ersetzt werden, sondern die Möglichkeit erhalten, die Veränderung mitzugestalten.
Ein zentrales Element ist der Aufbau neuer Kompetenzen. Dabei geht es nicht nur um technisches Wissen, es geht vor allem um die Fähigkeit, KI sinnvoll im eigenen Arbeitskontext anzuwenden. Schulungsangebote zu Themen wie datenbasierter Entscheidungsfindung, Prompt-Techniken oder dem Verständnis von Modelllogiken können hier unterstützen. Parallel sollten Unternehmen klären, wie sich Rollen aufgrund des Einsatzes von KI verändern bzw. welche neuen Rollen entstehen, etwa Data Stewards, KI-Projektverantwortliche oder Prozess-Coaches, und wie diese im Team sinnvoll verankert werden können.
Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt in der technischen Gestaltung der Anwendungen selbst. Je besser sich neue Tools in bestehende Prozesse einfügen lassen, desto höher ist die Nutzungsbereitschaft. Schnittstellen zu bekannten Systemen wie Microsoft 365, ERP-Lösungen oder Workflow-Plattformen helfen dabei, den Einstieg niedrigschwellig zu gestalten und die Technologie im Arbeitsalltag zu verankern.
Fazit: KI wird dann zur Chance, wenn die Grundlagen stimmen
Der Mittelstand muss keine Pionierrolle übernehmen, um von KI zu profitieren. Viel wichtiger ist es, die eigenen Prozesse zu kennen, konkrete Ziele zu formulieren und technologische Entscheidungen auf eine verlässliche Datenbasis zu stellen. Wer Use Cases mit Bedacht auswählt, die technische Architektur modernisiert und seine Mitarbeitenden aktiv einbindet, schafft die Grundlage für echten Mehrwert.
Künstliche Intelligenz ist demnach kein Selbstzweck. Sie ist ein Werkzeug – und wie bei jedem guten Werkzeug hängt ihr Nutzen davon ab, ob man weiß, wie und wo man es richtig einsetzt.
Link zu All for One Group SE: All for One Group – führende Consulting- und IT-Gruppe