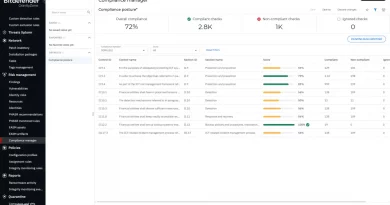Das voll vernetzte Unternehmen ist in Sicht
Hybride IT-Infrastrukturen sind die Zukunft
Die Daten als Rohstoff und Träger der digitalen Transformation benötigen eine Infrastruktur, die flexibel und agil genug ist, um nicht nur die Anforderungen von heute zu erfüllen, sondern auch die Ansprüche von morgen. In der Evolution der Systeme sind wir in einer hybriden Welt angekommen, und wir sind da, um dort lange zu bleiben. Firmeneigene Rechenzentren galten lange als Auslaufmodell, die Cloud als die einzige Alternative („Cloud only“). Aber dieses Konzept hat die Realität in den Unternehmen zu lange ausgeblendet, wenn nicht gar geleugnet: Kaum eine Organisation, die kein Start-up (mehr) ist und auf der grünen Wiese ihre IT aufbaut, wird die bestehende IT komplett migrieren können oder wollen. Dort stecken Investitionen in beträchtlicher Höhe drin, eine Menge Know-how und Best Practices und nicht zuletzt oft eine Legacy-IT, deren Wegfall nicht zu schließende Lücken in der Performance und Versorgung reißen würde.
Wir werden es daher auf Dauer mit hybriden IT-Infrastrukturen zu tun haben, die aus relativ frei skalierbaren Cloud-Umgebungen und firmeneigenen Rechenkapazitäten bestehen werden. Dazu kommen Edge-Komponenten, die an die Cloud angeschlossen sein können, aber nicht müssen – wenn sie aufgrund eigener Rechenkapazitäten ihre Aufgaben auch ohne erledigen können. Die Cloud hat sich dennoch längst flächendeckend durchgesetzt, und sie wird als „Cloud first“ immer dann eingesetzt werden, wenn es um die Einführung neuer Technologien gehen wird.
Unternehmen profitieren von hybriden Infrastrukturen, denn sie holen sie dort ab, wo sie sich befinden, öffnen ihnen aber alle Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln – über Best-of-Breed-Produkte unterschiedlicher Anbieter und Hersteller. Mit sogenannten Multi-Clouds, einem weiteren Trendwort, vermeiden sie auch den oft befürchteten Vendor-Lock-in, also die Abhängigkeit von nur einem Anbieter, der quasi-monopolistisch Preise und SLAs diktieren kann. Konkurrenz belebt eben auch im Cloud-Markt das Geschäft.
Aber Unternehmen werden dadurch auch herausgefordert: Eine Multi-Cloud ist deutlich aufwendiger zu administrieren. Die Integration ihrer Einzelteile ist komplex – auch, weil nicht jede Komponente offenen Standards genügt und offene Schnittstellen bietet. Es steht zu befürchten, dass viele unternehmenseigene IT-Abteilungen mit diesen Aufgaben über Gebühr beschäftigt sein werden und dann nicht wie gewünscht die Zeit haben, sich dem dringend benötigen Wertbeitrag der IT zu widmen. Allerdings gibt es im Ökosystem der Cloud-Anbieter auch Integrationsspezialisten wie die Software AG, die diese technische wie organisatorische Aufgabe als Service anbieten, um genau diesen negativen Effekt vermeiden zu helfen. Und so steht dem verteilten, dem „Distributed Computing“ nichts Prinzipielles mehr im Wege – vom firmeneigenen Rechenzentren über die Cloud bis zu den entlegensten Winkel unternehmerischer Tätigkeiten am Edge.
Nur verbrauchsbasierte Preismodelle bilden die gewonnene Flexibilität angemessen ab
Eins der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Versprechen der Cloud war immer, den Einstieg zu überschaubaren Preisen sowie ohne nennenswerten Investitionsaufwand und Kapitalbindung zu ermöglichen. In der eben skizzierten hybriden IT-Welt ist das wichtiger denn je, denn kaum ein Unternehmen wird den Einstieg in die Cloud zu denselben Kosten schaffen, die eine traditionelle Infrastruktur aufrufen würde.
Konsumbasierte Preismodelle erlauben nicht nur den Einstieg in hybride Infrastrukturen, sondern auch ihren Ausbau und den laufenden Betrieb. Die Ausgaben dafür erhöhen sich mit dem Verbrauch – und das ist die Basis dafür, dass Unternehmen den Einstieg schaffen, aber auch ausprobieren können, was genau sie dort tun, ob sie einen Service wirklich benötigen, wie sich die Skalierung nach oben rechnet und ob die digitale Infrastruktur wirklich zur Wertschöpfung beiträgt.
Konsumbasierte Preismodelle gibt es auch außerhalb der IT: So hat etwa Rolls-Royce vor ein paar Jahren ein Geschäftsmodell erfunden und damit sein Produktgeschäft abgelöst, bei dem die Turbinen gegen Zahlung eines Einmalpreises den Besitzer wechselten. Mit dem „Power-by-the-hour“-Modus werden nicht mehr die Triebwerke, sondern die Schubstunden an die Airlines verkauft, also nicht mehr das Produkt, sondern nur noch seine Leistung.
Ein „Truly Connected Enterprise“, ein durchgehend vernetztes Unternehmen, das den wichtigsten Rohstoff der Digitalisierung gewinnbringend einsetzt, ist also in Sicht – auch ohne Buzzwords und Megatrends, einfach mit der eigenen Kraft und mit Bordmitteln. Das ist jenseits der Prognosen eine sehr wichtige Botschaft an Unternehmen aller Branchen und Größen!